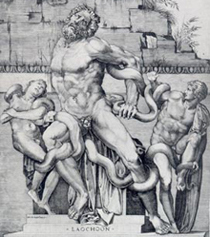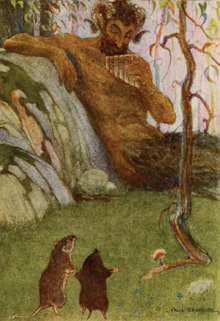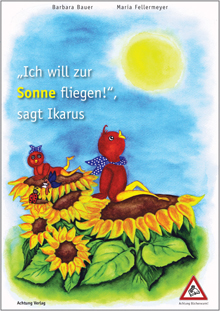Die ewigen Strafen ![]()
Der Tartaros ist der unheimlichste, finsterste, quälendste Ort des Hades, der griechischen Unterwelt. Wer gegen die Götter frevelte, musste nach seinem Tod (der meist unmittelbar nach dem Frevel eintrat) für alle Ewigkeiten ohne Hoffnung auf Erlösung im Tartaros leiden.
Aus dem Tartaros kennen wir drei Strafen, die in unseren Sprachgebrauch übernommen wurden:
1. Tantalosqualen: Wer Tantalosqualen erduldet, muss schreckliche Schmerzen (oder schreckliche Angst) ausstehen oder wird von ungestillter Begierde gepeinigt. Der mythische Tantalos muss als Strafe für seine Frevel bis zum Kinn im Wasser stehen. Sobald er seinen Kopf zum Trinken neigt, zieht sich das Wasser zurück. Gleich verhält es sich mit den Zweigen voll mit Früchten, die entweichen, sobald er nach ihnen greift. So leidet er schlimmste Qualen durch Hunger und Durst, obwohl die Erlösung so nahe wäre.
2. Sisyphosarbeit: Wer mit einer Sisyphosarbeit beschäftigt ist, hat eine besonders schwere, qualvolle Arbeit zu erledigen, die zur Erfolglosigkeit verdammt scheint und niemals zu einem Abschluss gebracht werden kann: man wälzt den Stein des Sisyphos.
Sisyphos muss laut griechischer und römischer Überlieferung als Strafe für seine Schlechtigkeit einen großen Stein einen hohen Berg hinaufrollen, der kurz vor Erreichen des Zieles wieder in die Tiefe rollt, so dass er von vorne beginnen muss.
3. Das sprichwörtliche Fass ohne Boden stellt ebenfalls eine Strafe im Tartaros dar. Wir meinen damit (meist) eine Person, der man immer wieder etwas geben muss: es ist ein vergebliches Tun, das „Fass“ füllen zu wollen, denn es nimmt alles in sich auf, ohne dass man einen Erfolg erkennt. In der griechischen Mythologie müssen die Danaiden, die Töchter des Danaos, die ihre Ehemänner in der Hochzeitsnacht ermordeten, bis in alle Ewigkeit Wasser in ein durchlöchertes Fass schöpfen. Von hier stammen auch die Redewendung „eine Danaidenarbeit verrichten“, „ins Danaidenfass schöpfen“, „das Wasser der Danaiden füllen wollen“ und „Wasser in ein Sieb schöpfen“.
Am Rande
Die Römer nannten die Hunnen „Tartaren“ – sie schienen ihnen wohl so furchterregend als wären sie der Hölle entsprungen.